Wir alle kennen sie – die Hassliebe zu unserem Job. Was uns in unserer Arbeit erfüllt und wieso sie uns manchmal nervt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Vor allem junge Leute streben nach einem guten Gehalt, Erfolg und Ansehen, während mit dem Alter eher die Sinnhaftigkeit im Job befriedigend wirkt. Welche Komponenten in Zukunft tendenziell zu einer erhöhten Arbeitszufriedenheit führen und was das Einkommen für eine Rolle spielt, erfahren Sie in diesem Interview.
Sie nervt, belastet und kann uns gleichzeitig erfüllen. Warum ist unser Verhältnis zur Arbeit so ambivalent, Herr Hirschi?
Gemäss Studien gibt es klare Merkmale, die einen Job für die meisten Menschen attraktiv ‒ und somit erfüllend ‒ machen. Dazu gehören unter anderem:
- Autonomie
- Vielfalt in der Aufgabenstellung
- Den eigenen Fähigkeiten entsprechende Anforderungen
- Soziale Unterstützung
Je mehr dieser Komponenten erfüllt sind, desto zufriedener sind die Arbeitnehmenden. Dazu kommt, dass bei jeder Arbeit auch ungeliebte Tätigkeiten erledigt werden müssen. Nehmen diese überhand, kippt die Stimmung schnell.
Der Druck auf Arbeitnehmende ist hoch. Stress scheint allgegenwärtig. Was tun?
Arbeitnehmende können noch so gute Strategien entwickeln ‒ ist der Druck zu hoch, ist Stress unvermeidlich. Daher gehört es in erster Linie zu den Aufgaben der Unternehmen sich zu überlegen, wie sie die Arbeit so gestalten, dass sie weniger erschöpfend ist: Stehen den Mitarbeitenden die nötigen Ressourcen zur Verfügung, damit sie den Anforderungen gerecht werden können? Wem genügend Zeit, Entscheidungsfreiheit und Kompetenzen für Aufgaben zur Verfügung stehen, erledigt seine Arbeit mit weit weniger Belastung. Und ist erst noch zufriedener.
Ist das bedingungslose Grundeinkommen ein möglicher Weg, wenn die Arbeitsgesellschaft endet?
Vielleicht. Was man bei dieser Diskussion aber oft vergisst:
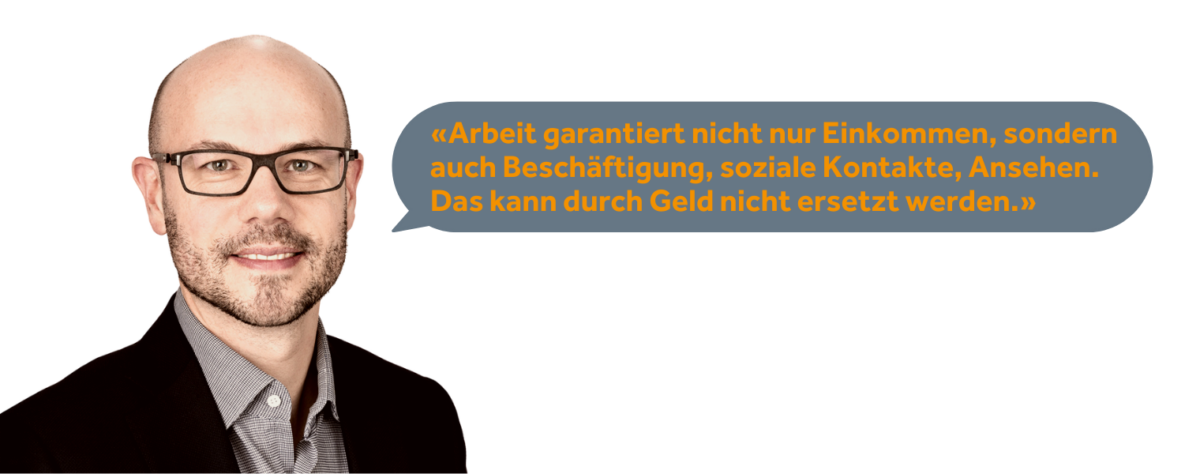
Zudem: Wie füllen wir dann unseren Alltag? Wir sind es nicht gewohnt, so viel freie Zeit zu haben. Unsere Gesellschaft ist auf Leistung gepolt und müsste sich grundlegend wandeln, damit das funktionieren könnte.
Selbstverwirklichung steht hoch im Kurs – auch im Job. Ist die Sinnsuche zu einer Art Trend geworden?

Das ist ein Wohlstandsphänomen: Die Bedürfnisse steigen überall. Man sucht nicht nur einen gut bezahlten, sicheren Job, er soll auch noch sinnstiftend sein. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns mit den Ansprüchen an uns selbst überfordern und scheitern: Erfolgreich im Beruf, souverän als Familienfrau, fit im Sport ‒ das sind hohe Ziele, die häufig mehr Stress auslösen, als dass sie glücklich machen.
Wie kann man Wert in der Arbeit sehen, wenn sich die eigenen Fähigkeiten nicht entfalten können?

Arbeit muss nicht im Zentrum stehen für ein gutes Leben. Kann man sich im Job nicht verwirklichen, kann er auch Mittel zum Zweck sein, um Dinge in anderen Lebensbereichen zu ermöglichen, die für einen Sinn machen.
Ist Sinnsuche in der Arbeit eine Altersfrage?

Tendenziell legen jüngere Arbeitnehmende mehr Wert auf traditionelle Werte wie Geld verdienen, Erfolg haben und Status erwerben. Mit dem Älterwerden tritt der Wunsch nach positiven Erfahrungen und Sinn in der Arbeit in den Vordergrund. Grundsätzlich ist aber für alle Altersgruppen wichtiger geworden, sich nicht nur über die Arbeit zu definieren.
Was ist bei der Suche nach einem Job mit Sinn zu beachten?
Als erstes ist die Wahl ausschlaggebend. Da gilt es genau hinzuschauen, denn nicht jede Arbeit ist motivierend und erfüllend. Anschliessend stellt sich die Frage: Was ist für mich persönlich wichtig und wie kann ich das in der Arbeit verwirklichen? Lässt sich das alles verbinden, ist die Chance gross, dass man mit seiner Aufgabe zufrieden ist.

Autor
Andreas Hirschi
Professor für Arbeits-
und Organisationspsychologie
an der Universität Bern

Kommentare